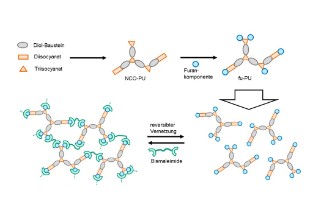Hier finden Sie eine kleine Auswahl unserer Forschungsprojekte.
Leichte Fahrzeuge und Baustoffe sind besonders energieeffizient. Mit Blick auf ein möglichst geringes Gewicht bei gleichzeitig guter Wärmedämmung kommen vielfach Verbundmaterialien zum Einsatz, die sich gar nicht oder nur sehr eingeschränkt recyceln lassen. Zudem bestehen sie meist aus petrochemischen oder anderen endlichen Rohstoffen. Gemeinsam mit Industriepartnern entwickeln wir eine ressourcen- und klimaschonende Lösung: recycelbare Leichtbaumaterialien auf Basis nachwachsender Rohstoffe mit individuellen Formgebungsmöglichkeiten. Besonderer Clou: Die Integration einer funktionalen Schicht soll die Herstellung von heizbaren Möbeln und Interieurbauteilen mit Beleuchtungsfunktion ermöglichen. Das Anwendungs- und Marktpotenzial ist branchenübergreifend sehr hoch.
mehr Info Fraunhofer-Institut für Holzforschung
Fraunhofer-Institut für Holzforschung